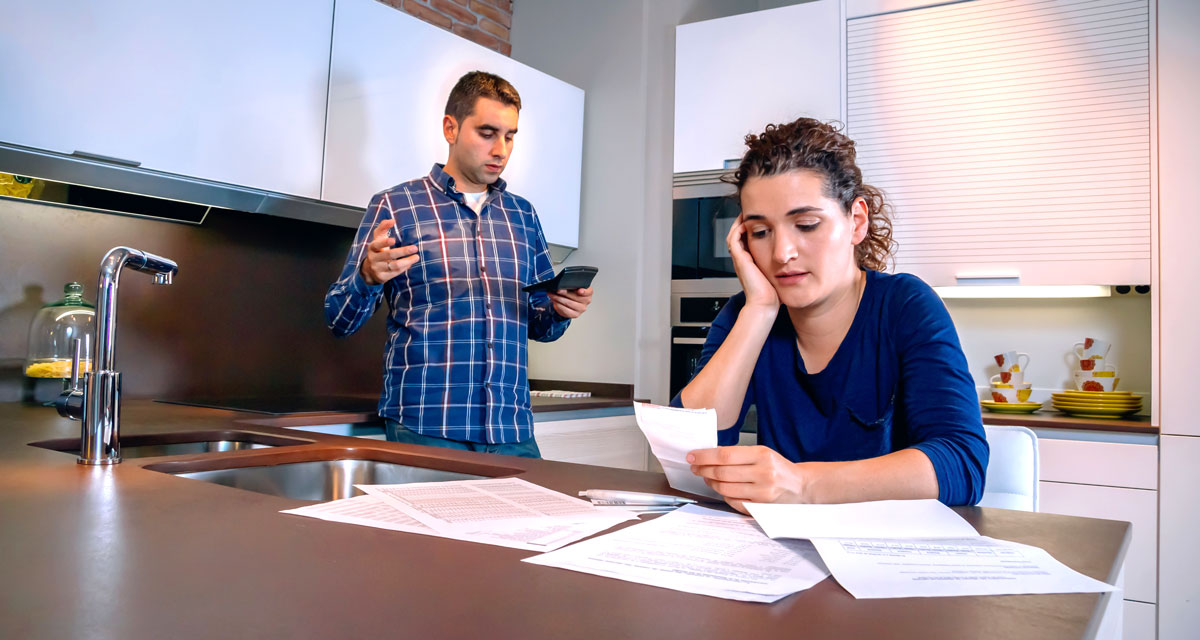
Die Privatinsolvenz
Wie vielen Tausenden anderer Bundesbürger kann es jedem passieren, daß er feststellen muß, daß er „pleite“ ist. Allein diese Einsicht, daß Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachgekommen werden kann, ist für viele eine große psychische Barriere. In dieser Phase wird ein, möglichst kaufmännisch vorgebildeter, Vertrauter benötigt, der sozusagen von außen für eine schonungslose Transparenz der Einnahmen und Ausgaben sorgt und die Begleitung auf dem weiteren Weg übernimmt.
Insolvenz – Es sind keine Einzelfälle
Es sind absolut keine Einzelfälle, daß plötzlich arbeitslose Angestellte und Freiberufler ohne Aufträge , die bisher ihre Verpflichtungen bezahlt haben ,nun nicht mehr zahlen können, und diese Situation sich auch mittelfristig nicht ändert.
Die Kosten laufen weiter: die Ratenkredite für das Auto und sonstige Anschaffungen müssen bedient werden, Lebenshaltungs- und Mietkosten müssen bezahlt werden und zu allem Überfluß kündigt die Hausbank wegen mangelndem Umsatz den Dispositionskredit und das Finanzamt möchte für das letzte Jahr eine dicke Steuernachzahlung. Der Supergau!
Verbraucherinsolvenz: Ein Weg zur Schuldenfreiheit
Da keiner mehr hilft, bleibt nur der Weg des Verbraucherinsolvenzverfahrens mit dem Ziel, den Betroffenen schuldenfrei zu stellen. Wobei immer zu unterstellen ist, daß nicht betrügerisch gehandelt wurde (Kreditschwindler etc.), sondern daß es sich um einen Schuldner handelt, der ohne eigenes Zutun in die mißliche Lage gelangt ist.
Außergerichtliche Schuldenbereinigung
Der Gesetzgeber sieht, im Gegensatz zur Regelinsolvenz, bei der Verbraucherinsolvenz eine Phase der außergerichtlichen Schuldenbereinigung vor. Das bedeutet, daß im ersten Schritt eine anerkannte Schuldnerberatung aufgesucht werden muß. Es gibt städtische und kirchliche Beratungen, als auch solche von Sozialverbänden. Diese haben, auf Grund des immensen Bedarfs, alle den Nachteil langer, mehrmonatiger Wartezeiten. Besser ist es, einen Insolvenzanwalt aufzusuchen, der kurzfristig agieren kann. Das kostet Geld.
Ist keines vorhanden oder handelt es sich um Hartz IV-Empfänger, ist bei der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts ein Berechtigungsschein zur Kostenübernahme erhältlich. Der Schuldnerberater berät und führt das außergerichtliche Verfahren durch. Die Phase des außergerichtlichen Ver-fahrens endet, unter der Annahme, daß die Schulden auch jetzt nicht bezahlt werden können, mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Insolvenzgericht. Der Antrag wird selbst gestellt und beinhaltet als Anlage ein umfangreiches Formularwerk, das entweder selbst ausgefüllt wird oder gegen Kostenübernahme (ca. 100 EU) vom Insolvenzberater.
Stundung der Verfahrenskosten
Zusätzlich zum Insolvenzantrag wird in der Regel ein Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten gestellt werden müssen. Die Gerichtskosten müssen nach Verfahrensende, d.h. nach 6 Jahren, bezahlt werden (ca.1500 EU). Es empfiehlt sich also, ein kleines, monatliches Dauersparen für diesen Zweck.
Die oben beschriebene Phase der außergerichtlichen Schuldenbereinigung bis zum Beschluß des Gerichtes zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens dauert ungefähr drei Monate. Schon zu Beginn der obigen Phase dürfen keine benannten Forderungen bedient werden.
Der Beschluß des Richters zur Eröffnung des Verfahrens beinhaltet die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit, die Benennung eines Rechtsanwalts als Treuhänder sowie den Prüfungstermin der Forderungen, der ca 3 Monate nach Beschluß liegt. Bei diesem Prüfungstermin besteht , soweit keine unerlaubten Handlungen begangen wurden, keine Anwesenheitspflicht.
Das eigentliche Insolvenzverfahren von der Eröffnung bis zur Aufhebung des Verfahrens dauert ca 9 Monate. Bei Aufhebung des Verfahrens kann das Gericht die Restschuldbefreiung in Aussicht stellen. Während dieser Phase kommt dem bestellten Treuhändler die Aufgabe zu, pfändbares Vermögen, so vorhanden, für die Gläubiger zu verwerten.
Die Wohlverhaltensphase
Nach Aufhebung der Insolvenz folgt die sogenannte Wohlverhaltensphase, in der ebenfalls die pfändbaren Teile der Einnahmen an den Treuhänder abgetreten werden müssen. Dieser verteilt dieses Geld einmal jährlich an die Gläubiger. Der Treuhänder erhält für seine Arbeit etwas über 100 EU jährlich, die bezahlt werden müssen. 6 Jahre nach Eröffnung kann das Gericht die Restschuldbefreiung erteilen und der Antragsteller ist schuldenfrei.
Nach Beschreibung des Ablaufs der Verbraucherinsolvenz ist erkennbar, daß der wesentliche Teil der Mitwirkung des Betroffenen vor den gerichtlichen Phasen liegt. Es ist aber sicher unabdingbar, daß eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Treuhänder anzustreben ist. Wie die Gesellschaft, mögliche Arbeitgeber oder Kunden auf die Insolvenz, so sie bekannt wird, reagieren, ist sicher fraglich. Juristisch ist aber auf Grund der Insolvenz keine Geschäftstätigkeit ausgeschlossen.
